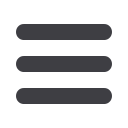
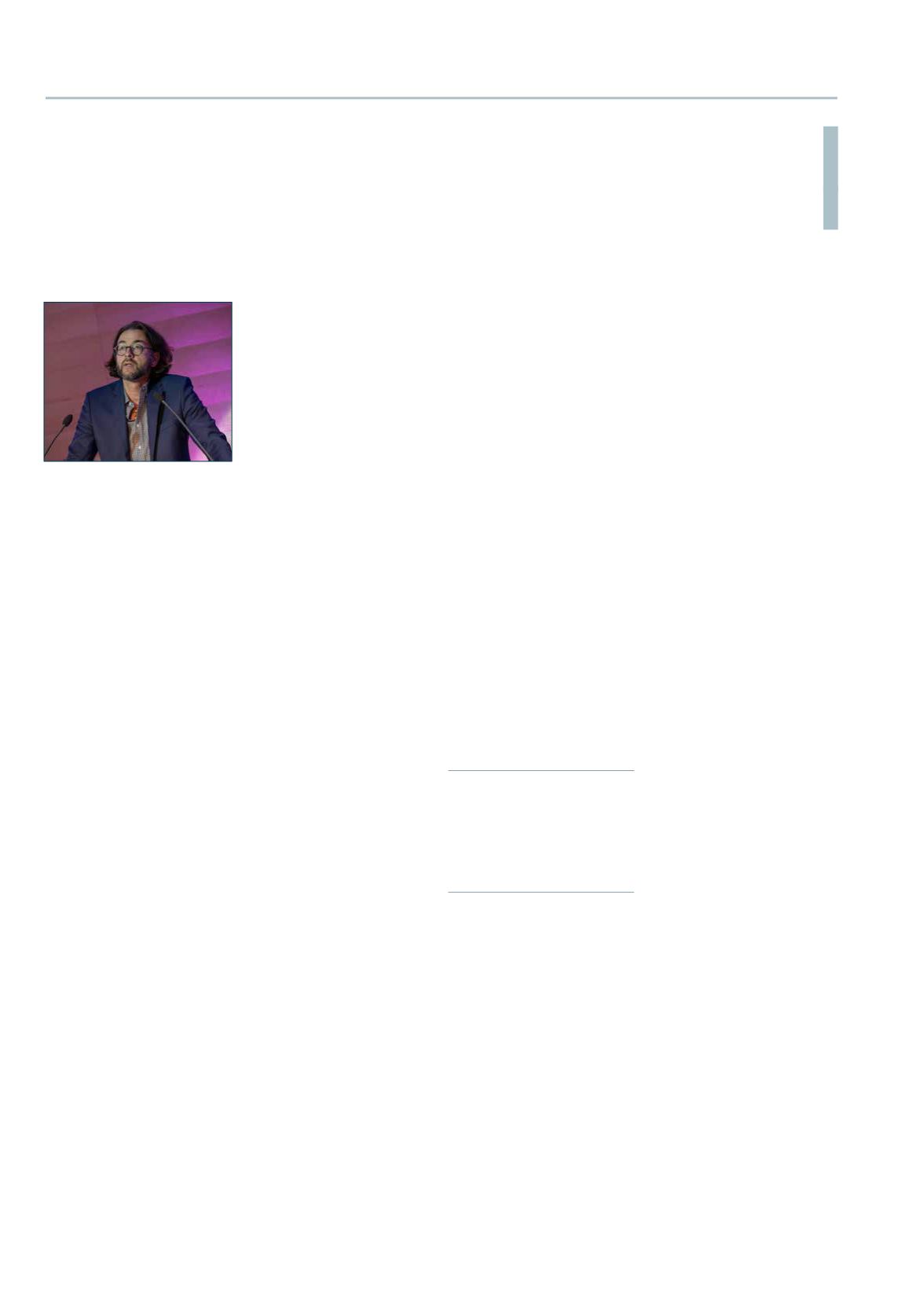
10 |
Ausgabe 05 | 2018 | 2. Jg.
Reflecting
Arbeit am eigenen Vorurteil
Rede an die Studierenden zum Studienabschluss
J
J
Jan Böhm macht deutlich, dass Begriffe ständig hinterfragt werden müssen, um nicht nur die
damit bezeichneten Sachverhalte zu verstehen, sondern sie auch verändern zu können.
Das Abschlusszertifikat einer päda-
gogischen Hochschule ist die Mate-
rialisierung einer Berechtigung. Die
Berechtigung, in einer staatlich aner-
kannten Schule pädagogisch tätig zu
werden. Gleichzeitig steht sie symbo-
lisch für die Gewährleistung bestimm-
ter, genau bestimmter Kompetenzen.
Man könnte sagen: Die Trägerin, der
Träger des akademischen Titels ist
hinreichend gebildet, um den Schul-
dienst aufzunehmen, aber nicht ausrei-
chend gebildet.
Aber dieser Spalt zwischen hinrei-
chend und ausreichend gebildet zu sein
bleibt bestehen. Bei jedem pädago-
gisch Tätigen. Man könnte auch ver-
allgemeinern, bei jedem tätigen Men-
schen. Dieser Spalt ist natürlich bei
jeder Person unterschiedlich groß, in
der Regel verkleinert er sich im Laufe
des Lebens, aber nicht automatisch,
sondern nur durch Anstrengung. Den-
noch ist auch bei größter Anstrengung
die Schließung des Spalts unmöglich,
sie muss es sein. Aus diesem Spalt
speist sich nämlich Ehrfurcht. Ehr-
furcht vor dem Zögling, Ehrfurcht
vor der pädagogischen Arbeit, nicht
zuletzt Ehrfurcht vor dem Leben, wie
Albert Schweitzer es formuliert hat.
Gleichzeitig sorgt dieser immerklaf-
fende Spalt für eine innere Unruhe,
eine notwendige, eine produk-
tive Unruhe. Sie ist hier gedacht als
Gegensatz zur absoluten Sicherheit.
Eine Sicherheit, die aus der Einsicht
resultiert, dass alles, was Ihnen als
Pädagoginnen und Pädagogen passie-
ren kann, unter Rückgriff auf Ihre hier
erworbenen Kompetenzen eindeu-
tig gelöst werden kann. Diese über-
zeugte Sicherheit wäre nicht nur dys-
funktional, sie wäre antipädagogisch.
Sie würde Ihren Bildungsprozess als
abgeschlossen imaginieren und jedes
dynamischen Moments entbehren.
Sie würde zu Selbstzufriedenheit und
Dünkel führen.
Der klaffende Spalt verhindert genau
diese Selbstzufriedenheit und pro-
voziert unablässig Zweifel. Keinen
fatalistischen Zweifel, sondern einen
produktiven Zweifel, wie er in der
Bildungsarbeit konstitutiv ist, kons-
titutiv sein soll. Der Zweifel beginnt
schon bei den Begriffen. Begriffe, oder
Sprache allgemein, sind die einzig uns
zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten der Welterschließung. Genau
das ist unsere Aufgabe, anderen zu
ermöglichen und zu helfen, sich die
Welt auf-zuschließen. Genauer müsste
man sagen: sich die Welt zu er-schlie-
ßen. Auch hier gilt: Das Ziel unserer
Bemühungen ist die Befähigung zur
Selbst-erschließung, zur hinreichen-
den Selbsterschließung, nicht zur aus-
reichenden Selbsterschließung. Das
wäre ein Selbstwiderspruch.
Begriffe strukturieren unsere Welt;
sie präfigurieren unsere Wahrneh-
mung, leiten unsere Kognition und
sind Grundlage unserer Entscheidun-
gen und somit unseres Handelns. Sie
machen Zusammenleben überhaupt
erst möglich. Aber unsere Begriffe sind
nicht neutral. Natürlich nicht, sie sind
in einem Deutungshorizont, einem
Deutungskosmos eingelagert, den wir
selten reflektieren und der uns nicht
selten gar nicht zugänglich ist, denn
er wäre ja wiederum nur mit dem glei-
chen Sprachwerkzeug erforschbar und
somit blind.
Man könnte überspitzt sagen: Begriffe
ermöglichen unser Denken und
beschränken es gleichermaßen. Einige
ziehen die Grenze zwischen Denkba-
rem und Nicht-Denkbarem im Sag-
barem, so wie ein berühmter Linzer
Schüler.
Begriffe geben unserem Denken ein
Geländer. Dieses ist am Anfang unse-
rer Denkarbeit auch nötig, es gewährt
Orientierung und Sicherheit; aber
ein Geländer gibt immer einen ganz
bestimmten, vor-gedachten, Weg vor.
Wirkliches, freies Denken ist daher,
um bei der Metapher zu bleiben und
Hannah Ahrendt zu zitieren, ein Den-
ken ohne Geländer.
Aber Begriffe sind überaus wichtig,
vielleicht immer dann, wenn sie nicht
reflektiert werden: Bildungsstandards,
Kompetenzorientierung, Selbsttätig-
keit, Freiheit, Demokratie, Evidenz,
Management, Mitbestimmung, Tole-
ranz, all diese affirmativen Begriffe
nutzen wir unzählige Male und sie
erzeugen in der Kommunikation mit
anderen ein Band der wohligen Über-
einstimmung. Gleichzeitig fühlt man
sich in schwesterlicher und brüderli-
cher Ablehnung gegenüber Begriffen
wie Autorität, Gehorsam, Unterord-
nung oder Vorurteile, besonders im
pädagogischen Feld. Aber vielleicht ist
das lautstarke Klimpern mit solchen
Begriffen kein Signal der Stärke und
Überlegenheit, sondern im Gegenteil
ein Signal für ein reflexives Defizit.
Es war vor allem der Philosoph Mar-
tin Heidegger, der sich schmerzlich
bewusst geworden war, dass den grund-
legenden menschlichen Daseinsbedin-
gungen mit der bestehenden, kontami-
nierten Sprache nicht näherzukommen
war. Er erfand neue Begriffe mit spe-
zifischen Bedeutungen, um sein phi-
losophisches Problem - was uns hier
nicht interessieren kann - zu erkunden.
Der Nachteil einer solchen Privatspra-
che ist, dass außer Eingeweihten kaum
jemand „Heideggerisch“ verstand und
somit seine Gedanken nur einem klei-
nen Kreis zugänglich waren und sind.
Soweit müssen wir aber nicht gehen,
um bestehende Begriffe auf ihre Sinn-
haftigkeit und ihre unausgesprochene,
aber wirkmächtige Bedeutung zu hin-
terfragen. Ich möchte das am Beispiel
zweier Begriffe exemplarisch aufzei-
gen. Ich wähle aus meiner Wortliste
je eins aus der positiv und eins aus der
negativ besetzten Gruppe.
Ich beginne mit dem Begriff der
Toleranz. Es ist ein alter Begriff, der,
zuletzt mit der Flüchtlingskrise, in
aller Munde ist. Er scheint der Zwei-
deutigkeit unverdächtig und verleiht
denen, die glauben sich tolerant zu ver-
halten, ein angenehmes Gefühl. Aber
was bedeutet es, tolerant zu sein? Wie
ist das Verhältnis beschaffen zwischen
denen, die Toleranz geben, und denen,
die Toleranz erfahren?
Verdeutlichen kann man sich das an
einem Beispiel: Man stelle sich vor,
die Burgenländer Kroaten oder die
Kärntner Slowenen würden beschlie-
ßen, dem Bundespräsidenten eine
Deklaration zukommen zu lassen, in
der sie mitteilen, dass sie von nun an
die österreichischen Österreicher tole-
rieren würden. Das klingt nicht nur
komisch, das wäre regelrecht absurd.
Hier deutet sich bereits etwas an: nicht
jeder, nicht jede Gruppe kann ande-
ren Personen oder Gruppen, Toleranz
angedeihen lassen.
Eine andere Perspektive: Man sagt:
„Ich toleriere diese religiöse Gruppe
oder diesen Verein“, beispielsweise.
Das gibt dem Toleranzgeber in der
Regel ein gutes Gefühl. Er weiß sich in
der Gewissheit, etwas Gutes getan zu
haben. Versuchen wir uns in den Tole-
rierten zu versetzen: Man antwortet
vielleicht Freunden, auf die Frage, wie
es sich in diesem Land lebt: „Ich werde
hier toleriert“. Vermutlich weckt das
nicht die gleichen positiven Gefühle
wie beim Toleranzgeber.
Eine letzte Perspektivänderung: Die
Frage nach der Freiheit. Der Toleranz-
geber hat die Freiheit zu entscheiden,
ob er Toleranz gewährt oder auch
nicht. Anders der Toleranznehmer: er
kann die Toleranz über sich ergehen
lassen, zurückweisen kann er sie nicht.
Er hat auch kein Recht, Toleranz ein-
zufordern. Der Toleranzgeber befindet
sich also im Besitz der aktiven und
passiven Freiheit, der Tolerierte besitzt
weder die eine noch die andere.
Deutlich geworden ist: zwischen dem-
jenigen, der Toleranz gewährt, und
demjenigen, der Toleranz empfängt,
herrscht kein egalitäres Verhältnis.
Toleranz setzt immer ein Machtge-
fälle voraus: Toleranz kann nur von
einer Person oder Institution vergeben
werden, die mehr Macht besitzt als
die Toleranznehmende Instanz, wobei
diese Machtüberlegenheit nicht zu
verwechseln ist mit Mengenüberle-
genheit. Die Mehrheit muss keines-
wegs mächtiger sein als eine Minder-
heit, aber oftmals ist es der Fall.
Toleranz ist also nichts anderes als eine
Überlegenheitsgeste. Freilich, eine in
der Regel gut gemeinte Geste. Aber
dennoch eine Überlegenheitsgeste
einer superioren Instanz gegenüber
einer inferioren Instanz. Wir geben
„Begriffe ermöglichen
unser Denken und
beschränken es
gleichermaßen.“
Foto: Privat

















